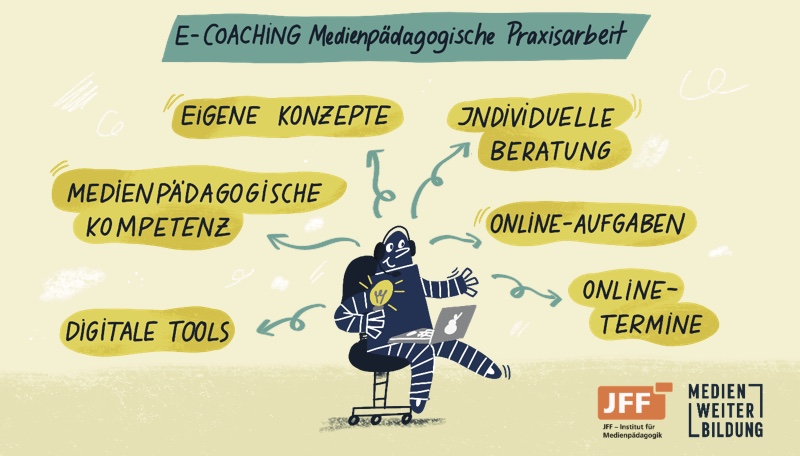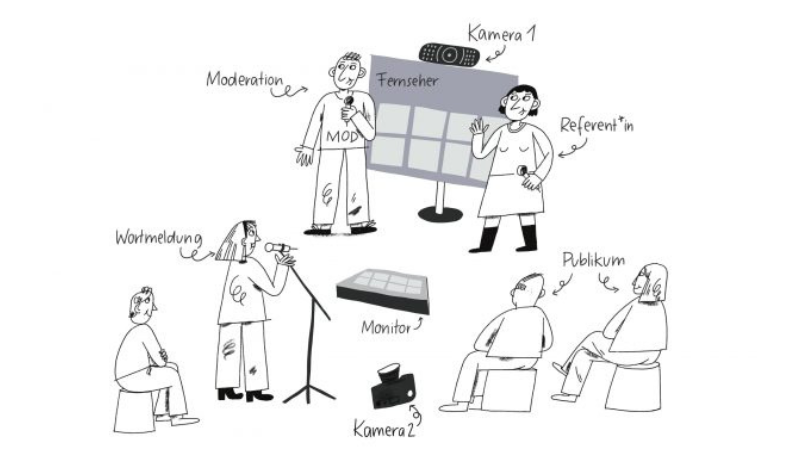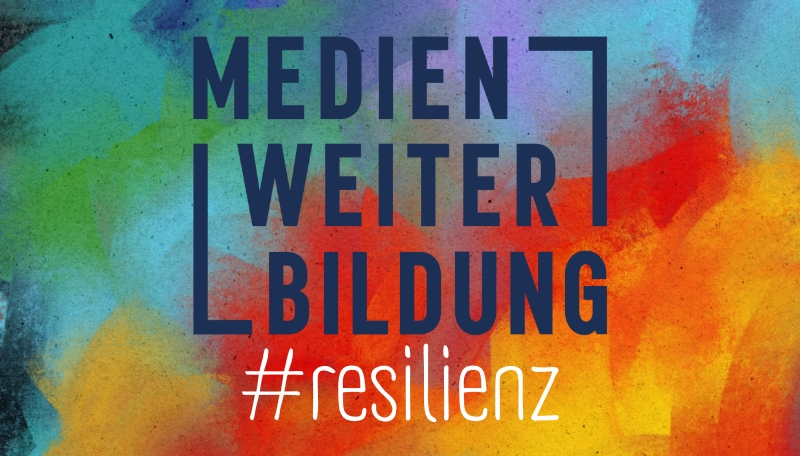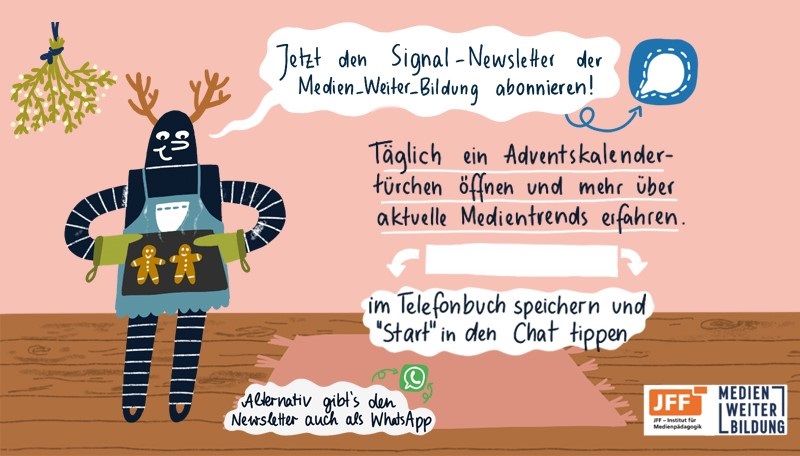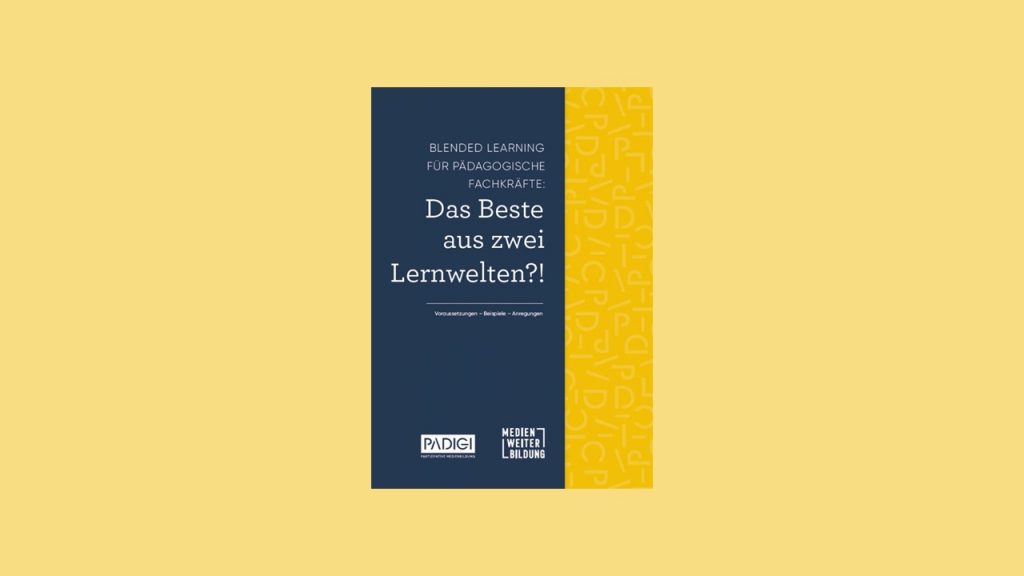Digital verbunden sein | Blended-Learning-Kurs 2024
Schwerpunkt Vernetzung Per Messenger kommunizieren, (Online-)Freundschaften schließen und pflegen, gemeinsam Computerspiele zocken oder Social-Media-Trends mitmachen – Kinder und Jugendliche nutzen Medien, um mit anderen verbunden zu sein und ihre eigene […]