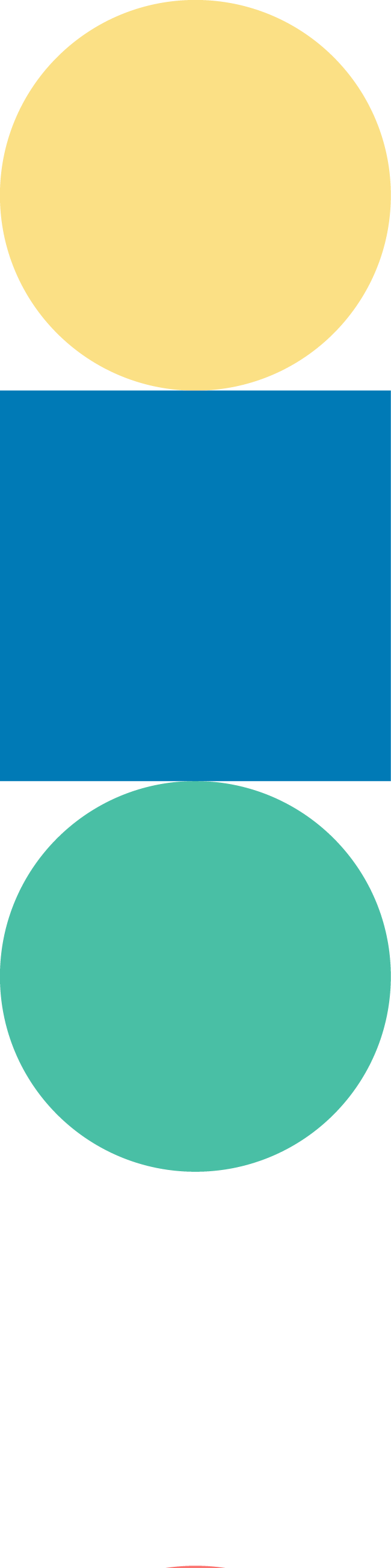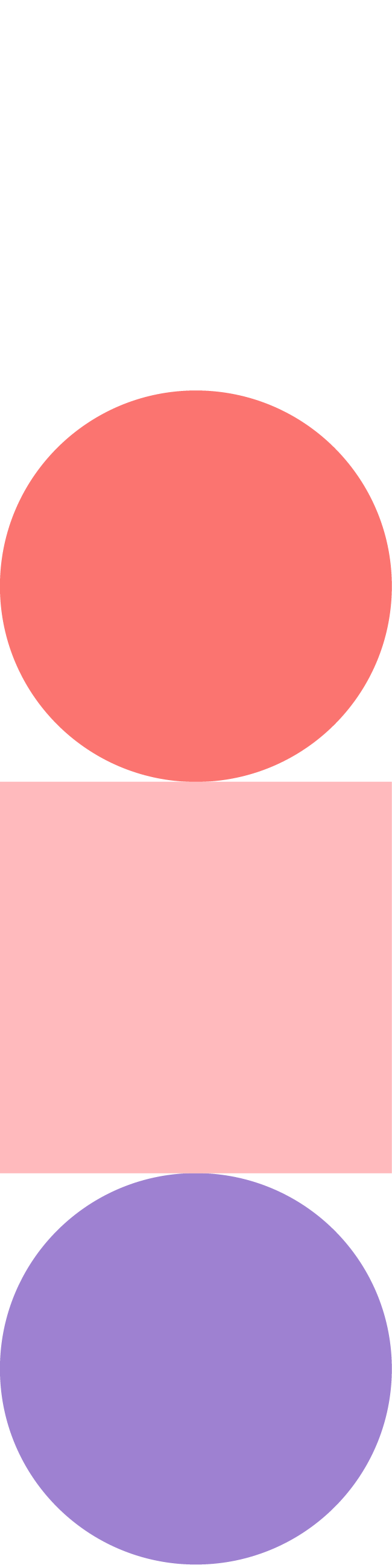Ausgehend von geschlechtsbezogenen Diskriminierungen in einer Gesellschaft, entwickelte sich die Strategie des Gender Mainstreaming, bei der vor allem die Aufhebung der Benachteiligung von Frauen als Zielvorgabe formuliert wurde. Um aber überhaupt diese Ungleichbehandlungen wahrnehmen zu können, ist eine spezifische geschlechtsbezogene Sensibilität in den Bereichen Chancengleichheit, Anti-Diskriminierung und Wissen um geschlechtsbezogene Spezifika notwendig. Zudem postuliert Gender Mainstreaming konkrete Ziel- und Handlungsvorgaben, um geschlechtsbezogene Benachteiligungen abzubauen. All diese gebündelten Fähigkeiten, d.h. die Sensibilität, das Wissen und Handeln in Bezug auf Gender, werden als Genderkompetenz bezeichnet.


Um genderkompetent agieren zu können, ist es daher zunächst wichtig, sich alle relevanten Aspekte der Geschlechterbezogenheit in der gesamten Breite sozialen Handelns zu vergegenwärtigen. Hierbei steht vor allem die Frage nach mangelnder Chancengleichheit im Vordergrund. Wenn Diskriminierungen und deren Ursachen generell analysiert werden sollen, ist es notwendig, Wissen über die gesamtgesellschaftlichen Wirkungsmechanismen für Benachteiligungen zu erwerben. Der zentrale Punkt ist hierbei „Macht“ und damit verbunden die Frage, wer mit welchem Motiv und welchen Methoden diese Macht durchsetzt bzw. durchsetzen möchte. Macht ist die notwendige Voraussetzung, um Diskriminierungen überhaupt realisieren zu können. Die Ursachen und die offenen oder versteckten Begründungen für Benachteiligungen liegen wiederum zumeist im Bereich von Vorurteilen, insbesondere von Geschlechterrollenstereotypen. Das Motiv für Diskriminierungen ist jedoch gar nicht in Faktoren wie Ethnie, Religion oder Geschlecht selbst zu finden, sondern schlicht in der Frage des historisch gewachsenen Machterhalts oder angestrebten Machterwerbs. Da Machtausübung sich in modernen Gesellschaften zunehmend über kommunikative Prozesse zu legitimieren sucht, ist es daher wichtig, Vorurteilen argumentativ entgegen zu treten. So gesehen, ist der stetige, eigene Wissenserwerb im gesamten Zusammenhang mit allen Fragen von Gender unabdingbar. Insbesondere die Diskussion um LGBTQI* erfordert hier eine Justierung des Genderbegriffs.

In einem zweiten Schritt der Genderkompetenz ist es notwendig, den Blick auf das eigene Denken und Handeln, dem eigenen geschlechtsbezogenen Verhalten, zu richten. Dieser reflexive Schritt ist bedeutsam, da ein Gutteil der Motivation, Gender Mainstreaming voranzutreiben, im eigenen Weltbild und eigenem, konkretem geschlechtsbezogenen Verhalten im Alltag zu finden ist. Ausschlaggebend, sich für Gender Mainstreaming einzusetzen, kann deshalb die Erfahrung der eigenen tatsächlichen oder gefühlten Benachteiligung sein, aber auch, einfach gesagt, das Motiv, generell für eine „gerechte Sache zu kämpfen“.
Im dritten Schritt, nach dem Erwerb von Wissen und der kritischen, eigenen Reflexion, beginnt die eigentlich schwierige Phase. Denn um Benachteiligungen aufzubrechen, ist jetzt das Handeln entscheidend. Dabei ist allerdings die oft gemachte Erfahrung einer geringen Selbstwirksamkeit keineswegs eine Frage der eigenen, mangelnden Kompetenz in Genderfragen, sondern vor allem die Folge von Machtstrukturen. Ein noch so emotionaler, sachlich fundierter Vortrag einer Frau aus der unteren Entscheidungsebene, wird in einer hierarchisch, von Männern dominierten Organisation kaum Spuren hinterlassen, oder gar Veränderungen provozieren. Daher erfordert Genderkompetenz auch stets kommunikative Kompetenz: Ohne Weiterbildung, Überzeugungsarbeit und weitere Mitstreitende kann es keine Veränderungen geben.
Ein interessanter Ansatz, um Diskriminierungen abzubauen, dürfte das sogenannte „Managing Diversity“ Konzept sein, das Ursachen für Benachteiligungen in verschiedensten Bereichen bekämpft. Ohne die mangelnde Chancengleichheit von Frauen aus dem Blick zu verlieren, werden hier weitere Faktoren miteinbezogen und versucht, sich dem Ideal, einer Chancengleichheit für alle, anzunähern. Individuelle Unterschiede in einer Gesellschaft werden dabei nicht als Faktoren zur Diskriminierung genutzt, sondern als Bereicherung durch Vielfalt begriffen.